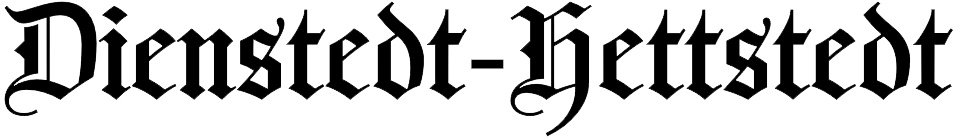Sächsischer Bruderkrieg
Die beiden Söhne von Friedrich IV. des Streitbaren[1], Friedrich II., der Sanftmütige[2] und Wilhelm III. der Tapfere[3], führten von 1446 bis 1451 Krieg gegeneinander. Nach der Erbteilung 1445 fühlte sich Wilhelm III., dem gemäß Altenburger Teilung die hochverschuldete Landgrafschaft Thüringen und die fränkischen Besitzungen zugesprochen worden war, gegenüber seinem Bruder übervorteilt. Dieser erhielt die westlichen Teile des wettinischen Herrschaftsgebietes. Wilhelm III. erreichte daraufhin in einem Schiedsgericht den Halleschen Machtspruch, der eine neue Aufteilung vorsah. Doch auch diese Teilung empfanden beide Brüder als nicht gerecht. Willhelm III. ließ sich in der Folge vor allem auch durch seinen Hofmeister Apel Vitzthum gegen seinen Bruder aufstacheln, wodurch sich ein jahrelanger, verheerender Krieg entwickelte.
1450 stand Friedrich II. mit 1600 - 1800 Mann vor Stadtilm, konnte es aber auch nach dreiwöchiger Belagerung nicht einnehmen.
Die Stadt wurde von Heinrich I. von Schwarzburg[4], welcher auf der Seite Wilhelms III. stand gehalten. Die Truppen brandschatzen beim Abzug das Land. Vermutlich wurde dabei die Burganlage von Großhettstedt sowie die umliegenden Dörfer und Kirchen zerstört. Seit dieser Zeit werden in Urkunden die Dörfer Maichlitz und Klunkersdorf infolge der Brandschatzung nicht mehr genannt.
Erst 1451 werden durch den Frieden von Naumburg die kriegerischen Handlungen beendet und die Landesteilung von 1445 bestätigt.